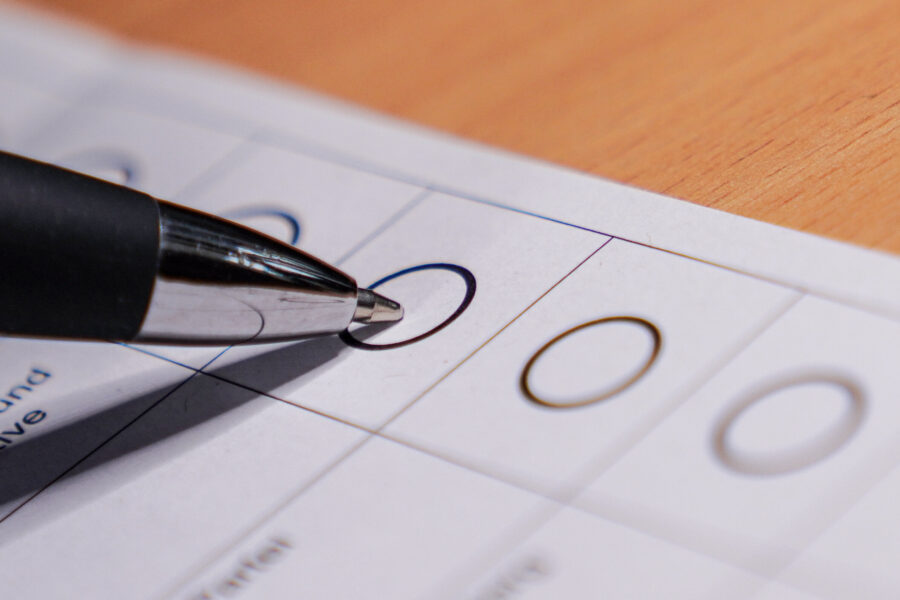Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Wie sich das neue Wahlrecht auswirkt

Die tief stehende Sonne beleuchtet den Bundesadler im Plenum des Bundestages. Hier werden künftig weniger Abgeordnete als bisher sitzen. Die Wahlrechtsreform begrenzt die Zahl auf 630.
IMAGO/photothek)Was ist beim Wahlrecht bei dieser Bundestagswahl neu?
Die Zahl der Abgeordneten im Bundestag wird auf 630 beschränkt. Und das bedeutet, dass jede Partei nur noch die Zahl der Abgeordneten aus den jeweiligen Bundesländern in den Bundestag schicken kann, die auch ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Hat eine Partei mehr Direktkandidaten durchgebracht als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, können die Kandidaten mit dem niedrigsten Stimmenanteil nicht in den Bundestag einziehen.
Gibt es dann Wahlkreise, die durch keinen Abgeordneten mehr im Bundestag vertreten sind?
Das kann grundsätzlich passieren, gilt allerdings eher als selten, wie bei der Anhörung zu Wahlrechtsreform im Innenausschuss deutlich wurde. I den meisten Fällen werde wohl ein Abgeordneter aus der Region von die Landesliste in den Bundestag einziehen.
Welche Auswirkungen hat die Wahlrechtsreform im Südwesten?
Genau kann man das bislang nicht sagen. Denn niemand weiß, wie die Menschen Erst- und Zweitstimmen verteilen werden. Zuletzt hatte rund ein Viertel der Wähler die Erststimme anders als die Zweitstimme vergeben. Die Bundeswahlleiterin hatte 2023 eine Beispielrechnung vorgenommen, wie sich das neue Wahlsystem auf die Bundestagswahl 2021 ausgewirkt hätte. Danach hätten es elf der damals 33 direkt gewählten CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg nicht in den Bundestag geschafft. Darunter wäre beispielsweise Diana Stöcker gewesen. Sie erhielt in Lörrach-Müllheim zwar das Direktmandat, aber nur mit 25,7 Stimmen. Maximilian Mörseburg aus dem Wahlkreis Stuttgart 2 und Annette Widmann-Mauz aus dem Wahlkreis Tübingen wären ebenfalls nicht in das Parlament eingezogen.
In Bayern wären neun der 45 direkt gewählten CDU-Kandidaten betroffen gewesen. Bei der SPD hätten es sieben Abgeordnete aus dem Saarland, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht in den Bundestag geschafft und ein AfD-Abgeordneter aus Sachsen wäre ebenfalls leer ausgegangen. Die FDP hatte keine Wahlkreissieger. Dort sind alle Abgeordneten über die Landeslisten eingezogen. Die Grünen hatten insgesamt Bundesweit nur 16 Direktkandidaten und genügend Zweitstimmen, so dass alle ihren Sitz im Parlament bekommen hätten.
Warum macht man sich derzeit in Tübingen Sorgen?
Die Situation in dem Wahlkreis ist speziell: Dort treten die langjährigen Kandidaten von CDU, Grünen und SPD nicht mehr an. Die Nachfolger sind bislang weniger bekannt und haben auf den Landeslisten Plätze im hinteren Bereich. Das bedeutet, in Tübingen wird wohl das Direktmandat über den Einzug oder Nichteinzug in den Bundestag entscheiden. Und der gelingt Christoph Naser von der CDU wahrscheinlich nur mit einem hohen Erststimmenanteil. Denn die CDU gewinnt traditionell mit der Erststimme die meisten Wahlkreise im Südwesten. Erhält sie weniger Zweitstimmen, fallen die Kandidaten mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis trotz Stimmenmehrheit im Wahlkreis raus. CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz hatte deshalb auch bereits deutlich gemacht, dass seine Partei keine Zweitstimmen zu verschenken habe. Früher hatte die FDP immer wieder insbesondere um Zweitstimmen von CDU-Wählern geworben.
Anders sieht es in Tübingen für Asli Kücük von den Grünen aus. Sollte sie das Direktmandat erringen, könnte sie ihren Sitz im Bundestag relativ sicher, da die Grünen bislang traditionell nur wenige Wahlkreise per Direktmandat gewonnen haben. Bei den anderen Parteien sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Tübingen eher auf hinteren Listenplätzen zu finden, so dass sie vermutlich per Zweitstimme nicht in den Bundestag einziehen werden. Zumindest nach den bisherigen Wahlprognosen.
Gründe für die Wahlrechtsänderung
Derzeit sitzen 733 Abgeordnete im Bundestag. Er ist damit das größte demokratisch gewählte Abgeordnetenhaus, obgleich dieses eigentlich nur 598 Abgeordnete haben sollte.
Grund war das bislang geltende Wahlrecht, wonach Parteien, die mehr direkt gewählte Kandidaten als Zweitstimmen hatten, Überhangmandate bekamen. Um den Stimmenanteil zwischen den Parteien nicht zu verfälschen, erhielten alle anderen Ausgleichmandate. Mit so vielen Abgeordneten wurde das Parlament teurer und die Arbeit aufwendiger und ineffizienter.