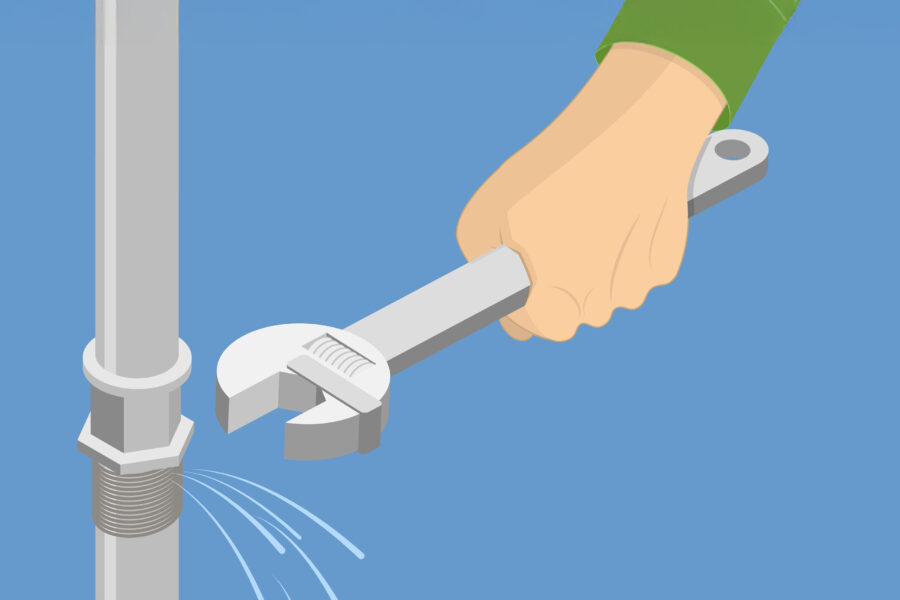Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Kein Direktauftrag bei Binnenmarktrelevanz

Die Grundsätze des EU-Vertrags müssen auch im Unterschwellenbereich beachtet werden, wenn ein grenzüberschreitendes Interesse besteht. Foto: IMAGO/U. J. Alexander
IMAGO/U. J. Alexander)NÜRNBERG . Seit dem 1. Januar 2025 dürfen kommunale Vergabestellen Aufträge bis zu einem Wert von 100 000 Euro direkt vergeben. Das erlaubt die neue Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (VergabeVwV). Der Direktauftrag geht im Wesentlichen auf den in der alten Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen erstmals im Jahr 2009 geregelten Direktkauf zurück. Damals betrug die Wertgrenze noch 500 Euro.
Das Vergaberecht findet beim Direktauftrag keine Anwendung
Ein Direktauftrag ist kein formalisiertes Vergabeverfahren wie eine Öffentliche Ausschreibung, sondern eine formlose Art der unmittelbaren Beschaffung. Das Vergaberecht findet dabei keine Anwendung. Auftraggeber müssen weder Fristen festlegen noch Vergabeunterlagen erstellen oder gar eine herstellerneutrale Leistungsbeschreibung abgeben. Ein Verhandlungsverbot gibt es nicht. Sie dürfen also mit den Unternehmen verhandeln. Der Direktauftrag wird in erster Linie durch die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eingeschränkt: Das Gebot, die verfügbaren Haushaltsmittel sparsam und wirtschaftlich einzusetzen, bedeutet, dass auch der Direktauftraggeber nicht nach Belieben beschaffen darf. Es gibt aber unterschiedliche Ansichten darüber, ob Direktaufträge neben den haushaltsrechtlichen Vorgaben auch europarechtlichen Beschränkungen unterliegen.
EU-Rechtsprechung legt Prüfung der Binnenmarktrelevanz nahe
Nach europäischer Rechtsprechung müssen die Grundregeln und allgemeinen Grundsätze des EU-Vertrags auch im Unterschwellenbereich beachtet werden, wenn ein öffentlicher Auftrag ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse auslöst. Dies erfordert eine eingehende Würdigung aller relevanten Gegebenheiten. Dazu gehört etwa das Auftragsvolumen, die geografische Lage des Leistungsorts, die technischen Merkmale des Auftrags und ernsthafte Konkurrentenbeschwerden.
Aufträge mit sehr geringfügiger wirtschaftlicher Bedeutung sind für andere europäische Wirtschaftsteilnehmer zwar meist uninteressant. Ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse kann aber nicht hypothetisch abgeleitet werden, sondern muss sich aus einer konkreten Beurteilung der Umstände des öffentlichen Auftrags ergeben. Dies urteilten die EU-Richter bereits 2016.
Die europäische Rechtsprechung legt somit großen Wert auf die Beurteilung der Einzelfallumstände, weshalb Verallgemeinerungen unzulässig sind. Im Gegensatz dazu generalisiert der Landesgesetzgeber in seinem Handlungsleitfaden für die Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen durch Landesbehörden: Nach Ziffer 10.7 ist eine Prüfung der Binnenmarktrelevanz bei Direktaufträgen nicht erforderlich.
Diese Empfehlung entlastet zwar die Vergabestellen, doch landesrechtliche Verwaltungsvorschriften oder Handlungsleitfäden können die aus dem EU-Vertrag folgenden und gerichtlich anerkannten Prüfungspflichten nicht außer Kraft setzen. Kommunale Vergabestellen, insbesondere in Grenzregionen, sollten daher die mögliche Binnenmarktrelevanz öffentlicher Aufträge sorgfältig prüfen.
Ein Gebäudereinigungsauftrag über 90 000 Euro im französischen Grenzgebiet könnte beispielsweise für Dienstleister in Frankreich sehr wohl lukrativ sein. Auch wenn ein Unternehmer aus einem anderen Unionsstaat sein Interesse an einem öffentlichen Auftrag tatsächlich und ernsthaft bekundet, kann dies ausreichen, um den nötigen Binnenmarktbezug zu bejahen.
Was ist bei grenzüberschreitendem Interesse zu tun?
Wenn ein grenzüberschreitendes Interesse festgestellt wird, müssen bestimmte Verfahrensanforderungen beachtet werden, die sich aus europäischen Grundsätzen ableiten und für einen Direktauftrag nicht erforderlich wären. Dazu zählt insbesondere eine ausreichende, vorherige Veröffentlichung, zum Beispiel im Internet. Je interessanter der öffentliche Auftrag für potenzielle Auftragnehmer ist, desto größer muss die Reichweite der Veröffentlichung sein.
Die Verpflichtung zur transparenten Bekanntmachung ist zudem untrennbar mit der Pflicht verbunden, ein faires und unparteiisches Verfahren sicherzustellen. Dies bedeutet insbesondere, dass alle Anbieter gleich behandelt werden müssen und die Vergabeprozesse transparent und gerecht sind. Dazu zählt auch die diskriminierungsfreie Beschreibung des Auftragsgegenstands.
Wettbewerb sicherstellen
Für Direktaufträge der Landesbehörden erteilte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus am 30. August 2024 auch folgende Hinweise: „Bei Direktaufträgen gleicher Art sollen die Vergabestellen zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln (Wechselgebot) und ebenso bislang nicht berücksichtigte Konkurrenten am Markt in geeigneten Fällen berücksichtigen. Auch beim Direktauftrag ist ein Mindestmaß an Wettbewerb sicherzustellen, um ein „Hoflieferantentum“ zu vermeiden. Ausnahmen vom Wechselgebot sind im Sinne einer Korruptionsprävention angemessen zu dokumentieren.“