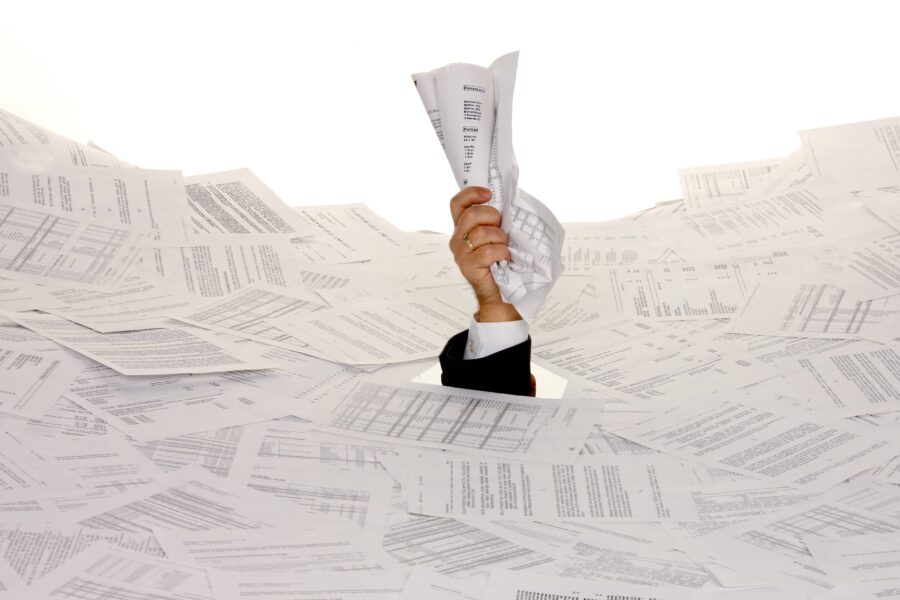Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Der Polizeiberuf: Facettenreich, vertrauensvoll und nicht ungefährlich

Chiara Faust (links) und Vivien Schötz erzählen Redakteur Ralf Schick, warum sie sich für den Polizeiberuf entschieden haben und davon begeistert sind. Fotos: Hochschule/nüsseler
Villingen-Schwenningen. Juni 2023: Auf dem Friedhof in Altbach bei Esslingen findet gerade eine Beerdigung statt, als ein Mann sich der Trauergemeinde nähert und eine Handgranate in die Menge wirft. Bei der Explosion werden zehn Menschen verletzt, der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen.
Die heute 25-jährige Vivien Schötz machte zu dieser Zeit gerade dort ihr Berufspraktikum und wird zum Einsatz gerufen. „Ich hatte die Hand schon an der Waffe, wir konnten den Fall aber ohne den Einsatz von Zwangsmitteln lösen“, erzählt die junge Studentin.
Im Einsatz unter Adrenalin wird alles um sich herum ausgeblendet
Schötz war auch schon bei einem versuchten Tötungsdelikt im Einsatz, wo fünf Männer auf einen anderen eingestochen haben. „Da ist man im Einsatz so fokussiert und steht unter Adrenalin, dass man alles um sich herum ausblendet und den Schalter umstellt“, erzählt Schötz.
Seit 2022 absolviert sie ihr Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Schötz will wie ihre Mitstudentin Chiara Faust (21) Polizeioberkommissarin werden, obwohl sie weiß, welchen Gefahren sie in diesem Beruf ausgesetzt ist. „Seit meiner Kindheit haben mich schon immer Streifenwagen fasziniert“, erzählt die 25-Jährige. Doch sie entschied sich zunächst für eine Ausbildung bei einer Bank, merkte aber schnell, „dass so ein Bürojob nichts für mich ist“.
„Ich habe schon als Kind immer Detektiv gespielt“, sagt die 21-jährige Chiara Faust. Ab der zehnten Klasse habe sich der Wunsch verstärkt, zur Polizei zu gehen, in der elften Klasse hat sie sich beworben und in der zwölften Klasse den Einstellungstest gemacht.
„In diesem Beruf hat man viel mit Menschen zu tun, man ist aufgehoben und kann seinen Kollegen und Kolleginnen in jeder Hinsicht vertrauen“, betont Faust. Während ihres Praktikums wurde sie zu einem fußläufigen Einsatz gerufen und verfolgte einen Straftäter. Dabei knickte sie um und erlitt einen Kreuzbandriss, auch sie hatte bei einem anderen Einsatz schon einmal die Hand an der Waffe, obwohl sie diese letztlich nicht einsetzen musste.
Trotzdem schwärmen beide von ihrem Beruf. „Dieser Beruf ist ein sicherer Beruf, den gibt es auch noch in vierzig bis fünfzig Jahren und er wird nicht irgendwann durch Künstliche Intelligenz ersetzt“, betont Chiara Faust. „Der Beruf ist abwechslungsreich, man hat Streifendienstkollegen, denen man voll vertrauen kann, man fühlt sich wohl“, sagt Vivien Schötz.
„Außerdem ist unser Beruf so facettenreich, es gibt viele Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und auch im Hinblick auf Familienplanung bietet er viele Möglichkeiten“, betont Faust. Und auch das Thema Sinnhaftigkeit spiele eine große Rolle, betonen die jungen Polizistinnen. Schließlich sei es ein gutes Gefühl, wenn man jemand helfen konnte und sei es nur, wenn ein gestohlener Geldbeutel dem Opfer wiedergebracht werden kann, betonen die beiden jungen Frauen.
Es gibt immer mehr neue Formen von Pöbeleien
Zugleich haben sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie bei Einsätzen zunehmend mit Respektlosigkeiten konfrontiert werden. Mal werde man angebaggert, „ein Mann wollte mal meine private Telefonnummer haben“, erzählt Schötz. Mal werde man auch sexistisch angepöbelt oder beleidigt, „es gibt immer mehr neue Formen von Pöbeleien, die Liste wird immer länger“, sagt Faust.
Das Gute sei auch, dass man während der Ausbildung und auch danach immer auch Menschen hat, denen man sich anvertrauen und Diensterfahrungen erzählen könne, betonen die beiden Polizeianwärterinnen.

An der Hochschule gibt es etliche Dozenten, die Psychologie studiert haben und es gibt auch ein psychosoziales Gesundheitsmanagement an der Hochschule. Zu den Kernaufgaben dieses Institutsbereichs zählen die Mitgestaltung einer gesundheitsförderlichen Führungs- und Arbeitskultur sowie die Unterstützung aller Polizeibeschäftigten im Umgang mit psychischen Belastungen. „Ich finde es wichtig, dass man im Einsatz keine Angst hat, sondern Respekt davor hat, das ist zur Eigensicherung sehr wichtig“, sagt Chiara Faust, „dem kann ich nur zustimmen“, ergänzt Vivien Schötz.
Dass man beim Polizeiberuf morgens nie weiß, was tagsüber auf einen zukommen wird, finden die beiden spannend. Und man muss auch körperlich fit sein, das ist auch Teil der Ausbildung. Deshalb gibt es an der Hochschule auch ein Fitnessstudio fürs Krafttraining. Und auch eine Tartanbahn für Ausdauerläufe, die zum Pflichtprogramm der Ausbildung gehören.
„Man muss viel wissen und auch sportlich sein“, sagt Schötz, denn der Beruf sei „sehr anspruchsvoll und beanspruchend“, betont Faust.
Doch der Polizeiberuf hat auch viel mit Bürokratie zu tun. Jeder Einsatz muss akribisch und detailliert beschrieben und dokumentiert werden. „Und zwar so, dass bei einem Strafverfahren vor Gericht die Anwälte und Richter genau nachvollziehen können, was am Tat- oder Einsatzort geschehen ist, denn die waren ja nicht dabei“, sagt Faust. Das setze in jedem Fall gute Deutschkenntnisse voraus, betonen die beiden.
Eine Ausbildung zum Polizeiobermeister dauert 30 Monate und enthält neben theoretischen auch umfangreiche praktische Anteile. Das Bachelorstudium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst, das Chiara und Vivien gerade absolvieren, dauert 45 Monate. Dazu zählen eine neunmonatige Vorausbildung, ein jeweils halbes Jahr lang dauerndes Grund- und Hauptpraktikum sowie das jeweils zwölf Monate dauernde Grund- und Hauptstudium.
Es gibt zwei unterschiedliche Schwerpunktbereiche im Studium
Im Bachelorstudium gibt es die Schwerpunktbereiche „Schutzpolizei“ oder „Kriminalpolizei“. Außerdem kann im Studienzug „Kriminalpolizei mit Vertiefung IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen“ ein weiterer Schwerpunkt gesetzt werden. „Im Wechsel zwischen Theorie- und Praxiseinheiten werden die Anwärterinnen und Anwärter optimal auf die Arbeit als Polizeioberkommissar/- in beziehungsweise Kriminaloberkommissar/-in vorbereitet“, heißt es dazu im Flyer.
Faust stammt ursprünglich aus Tübingen und möchte irgendwann auch gerne wieder in Heimatnähe arbeiten im Raum Tübingen und Reutlingen. „Und ich kann mir auch vorstellen, irgendwann eine Führungsrolle zu übernehmen“, betont die 21-Jährige.
Auch Schötz, die aus Esslingen stammt, würde am liebsten nach der Ausbildung im Raum Esslingen zum Einsatz kommen. „Am liebsten würde ich zur Polizei-Hundestaffel gehen, denn ich habe schon immer viel und gerne mit Hunden zu tun gehabt“, erzählt Schötz.
Eine Hochschule und acht Standorte in Baden-Württemberg
Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) ist für die gesamte Bildung der Polizei des Landes zuständig. Die Hochschule mit ihren Instituten Ausbildung und Training, Fortbildung sowie Management und Personalgewinnung verteilt sich auf insgesamt acht Standorte: In Villingen-Schwenningen befinden sich der zentrale Studienort, der Präsidialstab, Verwaltung und Management. Weitere Ausbildungsstandorte sind in Bruchsal, Lahr (mit einem zusätzlichen deutsch-französischen Sprachzentrum), Wertheim, Mosbach, Böblingen, Herrenberg und Biberach an der Riß (mit einer zusätzlichen Sportbildungsstätte).